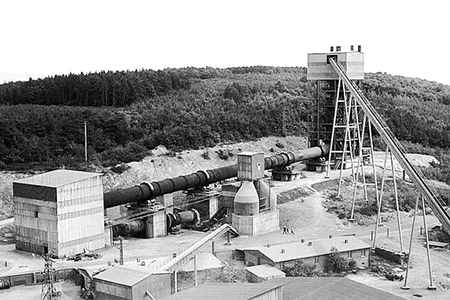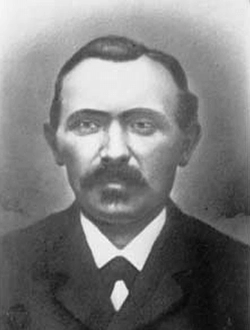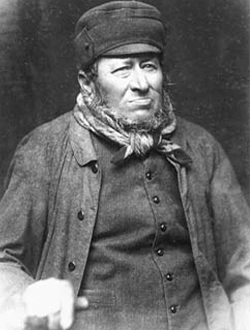|
|
45 Jahre Partnerschaft zwischen Ratten in der Steiermark und Waldalgesheim |
|
|
100+1 Jahre Freiwillige Feuerwehr Waldalgesheim |
|
|
|
|
|
Drei-Familienwohnhaus auf dem Gelände des „Alten Pfarrhauses“, Neustraße, bezugsfertig |
|
|
Kunstrasenplatz/Sportgelände an der Waldstraße wird seiner Bestimmung übergeben |
|
|
Gelände der Katholischen Kirchengemeinde mit Pfarrhaus, Wohnhaus, Pfarrheim und KiTa Regenbogen geht in den Eigentum der OG Waldalgesheim über |
|
|
Beginn der zweijährigen Corona-Pandemie, die das Gemeinde- und Vereinsleben lahmlegt |
|
|
Einweihung Bewegungsraum/Sportgelände Waldstraße |
|
|
Solarleuchten ergänzen die LED-Straßenleuchten |
|
|
Seniorenpflegeheim „Carpe Diem“ in der Neustraße nimmt Betrieb auf |
|
|
Ortsbürgermeister Stefan Reichert im Amt bestätigt |
|
|
Ortsbeleuchtung auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt |
|
|
Einzug in den umweltfreundlichen Rathaus-Neubau in der Kreuzstraße 2 |
|
|
Baugebiet „Waldstraße III“ mit 60 Bauplätzen fertiggestellt |
|
|
Erneuerung des Sporthallenbodens in der Keltenhalle sowie Einbau energetischer Fenster in der Sporthalle |
|
|
Erweiterung der „Rattener Stube“/ Keltenhalle |
|
|
Beginn der umfangreichen Ausgrabungen im geplanten Baugebiet „Waldstraße III“ mit Funden ab der Altsteinzeit (100.000 bis 40.000 vor heute) durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie Mainz |
|
|
Umzug in das Ersatzrathaus, Provinzialstr. 27 |
|
|
Verheerender Brand im Rathaus, Provinzialstr. 29 |
|
|
8., 9., und 10. Windrad wird fertiggestellt |
|
|
RuheForst Rheinhessen-Nahe wird erweitert durch 2. Teilabschnitt |
|
|
Fertigstellung der L214 in der Ortsdurchfahrt |
|
|
Stefan Reichert zum Nachfolger von Ortsbürgermeister Dr. Gerhard Hanke gewählt |
|
|
6. und 7. Windrad geht ans Netz |
|
|
5. Windrad wird in Betrieb genommen |
|
|
50 Jahre Katholische Kirche St. Dionysius |
|
|
Fertigstellung der Solar-Carports an der Waldstraße |
|
|
Vier große Windräder mit einer Leistung von bis zu 9,2 Megawatt für rund 6.000 Haushalte gehen ans Netz |
|
|
Fünf Photovoltaikanlagen auf den Dächern der fünf Gemeindehäuser installiert |
|
|
RuheForst Rheinhessen-Nahe nimmt seinen Betrieb auf |
|
|
Großes Jubiläum für drei Vereine: der Männergesangverein feiert sein 125-jähriges Bestehen, SV „Alemannia“ Waldalgesheim wird 100 Jahre alt und die Malteser bestehen seit 50 Jahren, der RuheForst Rheinhessen-Nahe im Waldalgesheimer Wald wird eröffnet |
|
|
Photovoltaikanlage auf der Keltenhalle in der Neustraße installiert |
|
|
1. Kinderfest im neuen Familienpark, Einweihung Kunstrasenplatz am Sportplatzgelände
|
|
|
neue Platzgestaltung an der Katholischen Kirche |
|
|
Waldalgesheim hat über 4.000 Einwohner
|
|
|
Photovoltaik-Freiflächenanlage auf Genheimer Gemarkung entlang der L214 zwischen Waldalgesheim und Stromberg geht ans Netz
|
|
|
Baugebiet „Waldstraße II“ mit 59 Bauplätzen fertiggestellt
|
|
|
Baugebiet „Waldstraße I“ mit 50 Bauplätzen ausgewiesen, Biomasse-Heizwerk geht ans Netz
|
|
|
Ankauf des ehemaligen Bergwerkgelände unterhalb der „Grube Doktor Geier“ durch die Ortsgemeinde als Naturschutzgebiet, Großbrand am alten Bergwerk
|
|
|
Ehemalige „Grube Doktor Geier“ wechselt den Besitzer
|
|
|
Baugebiet „Römerstraße“ mit 120 Bauplätzen fertiggestellt
|
|
|
Abschluss der Renovierungsarbeiten „Alte Schule“ Genheim
|
|
|
Fertigstellung des Gewerbegebietes „Römerstraße“
|
|
|
erste Direktwahl des Ortsbürgermeisters
|
|
|
Bau des kommunalen Kindergartens in der Hollerstraße
|
|
|
Bau der Keltenhalle in der Neustraße
|
|
|
Waldalgesheim feiert mehrere Tage sein 1.200-jähriges Bestehen und zählt 2.750 Einwohner (inkl. Genheim)
|
|
|
Waldalgesheim wird Partnergemeinde von Ratten in der Steiermark
|
|
|
Die Grube „Dr. Geier“ wird am 31. Dezember geschlossen, die Gemeinde erwirbt von der Firma Mannesmann große Flächen in der Nähe des Ortes
|
|
|
Genheim wird Ortsteil von Waldalgesheim, Waldalgesheim gehört zum Landkreis Bingen, Verbandsgemeinde Bingen-Land (heute: VG Rhein-Nahe)
|
|
|
Einweihung der neuen katholischen Kirche in der Kirchstraße
|
|
|
Fertigstellung der neuen Schule in der Schulstraße
|
|
|
Einweihung der neuen evangelischen Kirche in der Kreuzstraße
|
|
|
Gründung des Männergesangsvereins „Liederkranz“ Genheim
|
|
|
Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Waldalgesheim
|
|
|
Gründung einer sogenannten „Kinderbewahrschule“, Vorläuferin des katholischen Kindergartens
|
|
|
Tagesanlage „Dr. Geier“ wird auf dem „Stöckert“ errichtet
|
|
|
Gründung SV Alemannia Waldalgesheim
|
|
|
Gründung des Karnevalvereins Waldalgesheim
|
|
|
Einstellung der Arbeiten in der Grube „Braut“ bei Walderbach
|
|
|
Gründung des Bergmannsvereins „Glück Auf“ Waldalgesheim und Umgebung
|
|
|
Waldalgesheim zählt 1.162 Einwohner, Gründung eines Männergesangvereins
|
|
|
Einweihung der katholischen Kirche
|
|
|
Entdeckung des Fürstengrabes durch Peter Heckert
|
|
|
Grundsteinlegung der katholischen Kirche, Fertigstellung 1870
|
|
|
Katholisches und evangelisches Pfarrhaus werden in der Provinzialstraße gebaut
|
|
|
Abbau von Roteisenerz in der Grube „Braut“
|
|
|
Landstraße zwischen Stromberg und Bingen wird ausgebaut, katholische Schule in der Hochstraße und evangelische Schule in der Provinzialstraße werden errichtet
|
|
|
Bau der Schule in Genheim
|
|
|
Wiener Kongress beendet die französische Herrschaft im Rheinland, Rheinland und Waldalgesheim werden preußisch
|
|
|
Frieden von Luneville, das Rheinland wird französisches Staatsgebiet
|
|
|
Preußische Truppen überrennen die französischen Stellungen bei Waldalgesheim in der „Seeflur“
|
|
|
Im Zuge der französischen Revolution besetzen französische Truppen das Rheinland und somit auch Waldalgesheim
|
|
|
Waldalgesheim hat 458 Einwohner
|
|
|
Waldalgesheim gehört endgültig zur Kurpfalz
|
|
|
Erstmals Schulunterricht in Waldalgesheim
|
|
|
Kurfürst Friedrich I von der Pfalz erwirbt Teile des Dorfes Waldalgesheim
|
|
|
Waldalgesheim ist im Besitz mehrerer Herrschaften, Besitz wechselt fortlaufend
|
|
|
Urkundliche Erwähnung von Waldalgesheim ebenfalls in Urkunde des Klosters Lorsch
|
|
|
Urkundliche Erwähnung von Genheim in einer Urkunde des Klosters Lorsch
|
|
|
Christianisierung der Region
|
|
|
Fränkische Besiedlung, Franken gelten als die eigentlichen Gründer unserer Dörfer
|
|
|
Die „Via Ausonius“, eine römische Fernstraße von Mainz nach Trier durchquert die Gemarkung, römische Villen in Waldalgesheim und Genheim
|
|
|
Waldalgesheimer „Fürstengrab“ entsteht, keltische Besiedlung
|
|
|
verschiedene Siedlungsplätze in der „Nauwiese“ und in der „Rattener Straße“
|
|
|
erste nachweisbare Spuren menschlicher Siedlung
|